Ein Gespenst geht um in der Rock-Szene. Das Gespenst heißt Punk-Rock
Die häßliche Revolte
"Ich werde dir die Fresse polieren / Ich werde dich
umnieten / Ich werde dir die Zähne einschlagen / Ich werde dir die
Knochen brechen ..." Solche und ähnliche Angebote bekommen Englands
und Amerikas Rockfans seit gut einem Jahr zuhauf. Diesmal nicht von den
unverständigen Rednecks am Nachbartisch in der Snackbar und der Bier-Kneipe,
sondern von neuen Rockbands, die zur Zeit wie Pilze aus dem Boden schießen.
Und das in den Clubs und Pubs, in denen sich die Rockfreunde bislang wohl
und zu Hause fühlten.
Ein Gespenst geht um in der Rockszene. Das Gepenst heißt Punk-Rock.
Ihre "Nettigkeiten" adressieren die Musiker keineswegs an imaginäre
Bösewichte aus ihren Songtexten, sondern unverblümt an ihre
Zuhörer und Anhänger. Zwischen den Zeilen sammeln sie mitunter
etwas Spucke und verteilen sie mehr oder minder gezielt über die
vorderen Reihen. Sie kippen ihre Becher nicht immer nach hinten aus und
kicken die Bierdosen schon mal locker über die Rampe.
Dazu machen sie einen Höhenlärm. Nicht mit 20 000 Watt, dazu
fehlt's ihnen am Geld. In den Klubs und Kneipen, den Vorstadthallen und
Aulen, auf die die Punk-Bands noch immer beschränkt sind, reichen
auch paar hundert oder tausend bis zweitausend Watt, um die Fans platt.zuhämmern.
Fast wichtiger als die obligate Lautstärke ist das Tempo. Die Punk-Rocker
entpuppen sich als wahre Dauer-Sprinter. Sechs Songs in zehn Minuten ist
ein ansehnlicher Schnitt. Sie rattern ihre aggressiven Stücke nur
so herunter. Feuern sie ab, wie Salven aus dem Maschinengewehr. Das geht
mit Höchstgeschwindigkeit los und hört mit demselben Zahn auf.
Keine Spur von Aufbau und Entspannung, ohne Punkt und Komma. Folglich
ohne Höhepunkte.
Sie pfeifen darauf, wie sie aussehen. So scheint es, wenn man sie sieht.
Aber sie pflegen ihre Zerschlissenheit. Sie erzeugen die Abnutzung auch
künstlich, wenn es sein muß. Malcolm McLaren, der Mentor und
Manager der Sex Pistols, erinnert sich daran, wie ihm sein späterer
Schützling Johnny Rotten (19) zum erstenmal über den Weg lief:
"Ich mochte seinen Kleidungsstil." Rotten tauchte immer wieder
in der Boutique des ehemaligen Kunststudenten McLaren auf, in einem Anzug,
den er vorher zerschnitten und mit Sicherheitsnadeln wieder behelfsmäßig
zusammengeflickt hatte. Johnny ist innerhalb eines Jahres zum Enfant Terrible
Großbritanniens und zum Prototyp des Punk Rockers avanciert. Seine
kurzen Haare stehen störrisch in die Luft und sind grün und
orange gefärbt. Seine Unterarme zeigen häßliche Brandmale
von Zigarettenkippen, die er sich daselbst ausgedrückt hat.
 |
||
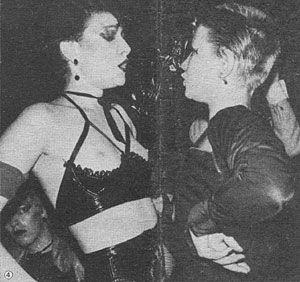 |
 (1) Sicberheitsnadeln, Hundeleinen, Nazi-Symbole und Schminke stehen für ein Gemisch aus Armut, Protest und Brutalität (2) Sado-Masochismus in der Show von Cherry Vanilla (3) lm US-Punk geht es mehr um Witz und die Koketterie mit der Bisexualität: Wayne County (4) Punks im Londoner Roxy Club (5) Johnny Rotten |
|
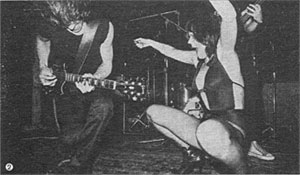 |
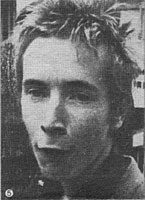 |
|
Die Musikpresse reagierte zuerst mit schweigsamer Verachtung.
Doch hat sich die Einstellung innerhalb des letzten Jahres rapide gewandelt.
Selbst wenn in vielen Redaktionsstuben immer noch dieselbe Geringschätzung
vorherrscht, den außerordentlichen Reizwert des Punk-Rock haben
die meisten erkannt. Belustigt sich Johny Rotten: "Es gibt bereits
mehr Artikel über Punk-Bands als Punk-Rock-Songs, geschweige denn
Platten."
Die bewußt aufmüpfigen Frechheiten von diversen Punkern kamen
auch der Tagespresse zupaß. Im ganzen vereinigten Königreich
brach Anfang des Jahres ein Sturm der Entrüstung los, als Johnny
Rotten den Fernseh-Interviewer BiII Grundy in einer Live-Sendung als "dirty
fucker" und "fucking rotter" (etwa: dreckiger Scheißkerl
und verdammter Quatschkopf) beschimpft hatte. Im allgemeinen muß
man Buhmänner erst suchen, die Punk-Rocker bieten sich freiwillig
auf dem Tablett an. Als Rotten dann noch in derselben Sendung der Queen
einen neuen Sex Pistols-Song widmete, hatten die vier Sex-Pistolen den
Rubycon überschritten. Ihr fester Plattenvertrag von 40 000 Pfund
mit EMI, dem größten Schallplattenkonzern der Welt, platzte
nach Tagen öffentlicher Kontroversen.
Trotz landesweiter Achtung schloß wenige Wochen später der
Plattengigant A&M mit den Sex Pistols einen Zweijahres-Vertrag über
150 000 Pfund (615 000 Mark) ab. Nach nur sieben Tagen und einer Schlägerei
der Sex Pistols mit dem TV-Musikmoderator Bob Harne kündigte A&M
den Vertrag wieder auf. Nicht ohne die Band mit 75000 Pfund zu entschädigen.
Über die Gründe der Trennung herrscht Rätselraten.
In jedem Fall fragt man sich, weshalb eine scheinbar so systemfeindliche
Band wie die Sex Pistols so scharf auf system-konforme Geschäfte
mit der Plattenindustrie ist. Dabei propagieren sie die Herrschaftslosigkeit
im Vereinigten Königreich ("Anarchy in the UK'). Dabei bezeichnen
sie das derzeitige England als faschistisches System. In ihrer letzten
Single "God Save the Queen", die in 25 000 Exemplaren gepreßt
und kurz darauf wieder eingestampft wurde, heißt es: "Gott
schütze die Königin, ein faschistisches Regime / Es macht einen
zum Idioten, ist gefährlich wie eine H-Bombe / Gott schütze
die Königin, das unmenschliche Wesen / Englands Traum kennt keine
Zukunft." Dabei demonstrieren sie eine bewußt häßliche
Anti-Ästhetik, die die Verhältnisse nicht verschleiern, sondern
die Unterprivilegiertheit hervorheben soll. Da musizieren sie bewußt
an den aufwendigen und geschliffenen Klangwelten der Yes, Pink Floyd,
ELP, des Elton John und anderer Rock-Millionäre vorbei. Rauh und
grob poltern ihre wenigen Platten durch die Stereo-Anlagen, Ohren und
Hirne der Rockfans. Aber anders als zum Beispiel April Records in Deutschland
oder Love Records und Silence Records in Skandinavien entwickeln die Punk-Rocker
keine alternativen Systeme.
Johnny Rotten klingt nicht ganz glaubwürdig, wenn er sagt: "Was
sich hier abspielt, soll nicht nur wie ein Aufstand gegen die Musik-Szene
aussehen. Verdammt nochmal, es ist einer."
Wenn Rat Scabies von der Punk-Band The Damned (Die Verdammten) mit einiger
Berechtigung feststellt, daß die berühmten Bande alle reich
geworden sind und vergossen haben, wo sie eigentlich herstamrnen, dann
kann man nicht übersehen, daß Punk-Kollege Rotten und Co. in
wenigen Wochen über 400 000 Mark Abfindungen für geplatzte Verträge
bekommen haben und noch viel mehr bekommen hätten, wenn die Verträge
erfüllt worden wären. Die Plattenindustrie liegt auf der Lauer,
aus den Punk-Bands ihre Umsatzbringer von morgen zu rekrutieren. Bis zur
unverwindbaren Majestätsbeleidigung ist sie bereit, alles zu schlucken.
Rock hatte schon immer mit Auflehnung zu tun. Hatte sich ein neuer Stil
erst mal Bahn gebrochen, wurden Fragen der Form wichtiger als des Inhalts.
Dann wurde Unterhaltung wichtiger als Aussage. Punk-Rock ist eine Spielart
der ständig wiederkehrenden Revolten aus dem Untergrund. Diesmal
bäumt sich eine Gruppierung auf, die sich nicht nur gegen die herkömmlichen
Autoritäten durchzusetzen hat, sondern auch gegen die in den letzten
Jahren frisch etablierte Hierarchie der Rock- und Popwelt.
Der Aufstand gegen die Neureichen der Rockwelt war abzusehen.
Winfrid Trenkler
(Quelle: Musik JOKER 2.5.1977 - Musik JOKER war ein Produkt des Axel Springer-Verlags)
Fresse / Information Overload