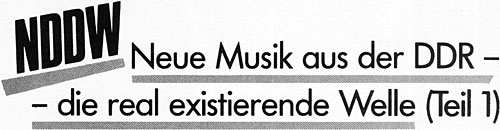
NDDW
Neue Musik aus der DDR - die real existierende Welle (Teil 1)
Samstag 16 Uhr - Berlin, Hauptstadt der DDR - Haupteingang Palast der Republik. Die erkaltete DDR-Billig-Zigarette "Karo" in der Linken, einen Haufen Zick Zack-Platten in der Rechten, gehen wir nervös auf und ab.
Von Tim Renner und Thomas Meins
Eine halbe Stunde vergeht. Aus dem Palast tönt das mittelmäßig
intonierte "Rosen aus Amsterdam", da kommt von rechts ein Punk-Pärchen
auf uns zu. Unsicherheit auf beiden Seiten - Blicke gehen hin und her.
Eine Viertelstunde dauert es, bis man, sichtlich erleichtert, die vereinbarten
Erkennungszeichen entdeckt. Gemeinsam warten wir auf unsere anderen, schon
längst überfälligen, Gesprächspartner. Ausgerechnet,
als gerade ein ganzer Schwall braver DDR-Bürger den Palast verläßt,
tauchen die zehn unübersehbaren und unüberhörbaren jungen
Herren auf. Eindeutig, die wollen nicht in den Palast, sondern ins SOUNDS!
Es war schon oft so, daß in der DDR Moden, die in den kapitalistischen
Staaten entstanden sind, mit einer fünfjährigen Verspätung
übernommen wurden. Wir haben jetzt das Jahr 1982. Ist nun für
die DDR die Zeit der 76/77er Punkbewegung und die Aufsplitterung der Jugend
in Modebewegungen gekommen? Auf den ersten Blick, ja! Auf den Straßen
sieht man Jugendliche, die sich bemühen, wie Punks auszusehen. Man
trägt Stoppelhaarschnitt, bastelt sich selber Badges und ist mit
Sicherheitsnadeln bestückt. Die Reaktionen der DDR-Bevölkerung
errinnern durchaus an das, was man hierzulande vor fünf Jahren als
Punk erlebte.
Popper, Punks und Bluesfans seien die in der DDR vorherrschenden Jugendbewegungen.
Die Popper sind nicht direkt mit den hiesigen zu vergleichen. Die Abstammung
aus meist gutem Hause haben sie zwar gemeinsam, doch die DDRler sind viel
aggressiver. Es kommt bei fast jedem Konzert, bei dem auch Punks anwesend
sind, vor, daß die Popper eine Schlägerei inszenieren. Eine,
für die BRD unbekannte, Jugendgruppe sind die Bluesfans. In diese
Gruppe wird der ganze Rest, von Friedensfuzzies bis zu Pennern und Rockern
eingestuft. Auch die Punks sind sich da nicht ganz einig, wer dazu gehört
und wer nicht.
Man darf es sich nicht so einfach machen, in der DDR-Jugend
nur Nachahmer westlicher Modebewegungen zu sehen. Die Systeme und Lebensbedingungen
sind zu unterschiedlich, als daß diese Bewegungen einfach auf die
DDR projiziert werden könnten. Bei der Musik wird das besonders deutlich.
In der BRD war die Entstehung einer neuen Musikbewegung mit der Entwicklung
unabhängiger Labels und Vertriebe untrennbar verbunden, einem Phänomen,
das im kapitalistischen Wirtschaftssystem, nicht aber im real existierenden
Sozialismus der DDR möglich ist. Trotzdem gibt es dort sowohl eine
offizielle, als auch eine im Untergrund entstandene neue Musik-Szene,
die man in der DDR "neue Töne" nennt.
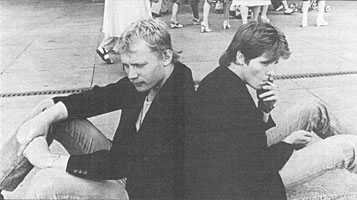 |
|
DDR-Band Tapeten-Wechsel (Foto: Ute Henkel)
|
Die Arbeitsbedingungen der Müllstation sind nicht untypisch. Mit dem Dachboden als Übungsraum sind sie sogar noch gut bedient. Andere Gruppen spielen, solange wie ihre Nachbarn das aushalten, im Wohnzimmer. Auch in Schulen bestehen keine Übungsmöglichkeiten. Die Band Wisch & Weg holte sich beim Musillehrer mit den Worten "Wollt ihr wirklich hier mit Mamis Topfdeckeln euern Krach machen", eine Abfuhr.
Obwohl Instrumente und Verstärker in der DDR selten
und teuer (richtig gute kann man sowieso nur auf dem Schwarzmarkt erstehen),
und die Chancen, einen richtigen Übungsraum zu bekommen, minimal
sind, resignieren die Untergrundbands nicht. Man erkennt seine, wenn auch
minimalen, Möglichkeiten und versucht, diese maximal auszunützen.
Was unter diesen Bedingungen dann entsteht, ist verblüffend! Die
Bands schaffen es, diese Mangelsituation durch viel Originalität,
Fleiß und Experimentierfreude wettzumachen. Der Gruppe Müllstation
gelingt es, mit dem "einfachsten" Schlagzeug, das verblüffend
echte Klangbild eines Zuges entstehen zu lassen. In einem Stück,
das die Band "Sando Chan" nennt, klingt es dann auch nicht so,
als wäre es auf dem winzigen Dachboden, sondern in einer großen
Halle eingespielt worden. Eine andere Gruppe, das Duo Menschenschock experimentierte
solange mit ihrer Wandergitarre, bis sie es dann schaffte in ihrem Song
"Elektrozaun", diese tatsächlich das Knistern des Zaunes
nachahmen zu lassen. Alle Bands geben sich bei jedem einzelnen Stück
unglaublich viel Mühe. Einen BRD-Bürger verblüfft das,
denn von den hiesigen überfütterten Bands ist man das nicht
gewohnt, DDR ist, wenn man trotzdem lacht!
Neben, wenn auch mit minimalen Mitteln erzeugten Raffinessen, präsentiert
der Untergrund noch viel Humor. "Ich habe eine Fliegenklatsche, mit
der mach' ich batsche, batsche", singt Rolfo am Ende der Menschenschock-Cassette.
Unter anderen kulturpolitischen und ökonomischen Bedingungen könnte
aus der DDR eine wirklich neue, gute Musik kommen (oder gerade nicht?
- Red.). Schade, daß nicht alle so dastehen wie die Gruppe Tapetenwechsel.
Sie haben etwas Geld, Geschick und vor allen Dingen viel Glück. Deshalb
haben sie auch als einzige der Bands eine halbwegs vernünftige Ausrüstung.
 |
|
Die Punks der DDR hören die Signale (Foto:
Ute Henkel)
|
Viel bedeutet das noch nicht für Tapetenwechsel.
Wer in der DDR zum Popstar werden will, muß sich und seine Musik
erst einmal durch Organe der staatlichen Kulturpolitik absegnen lassen.
Einfach im Club um die Ecke auftreten, ein Studio mieten oder zur nächsten
Plattenfirma laufen, das geht nicht. Nehmen wir an, Tapetenwechsel will
hoch hinaus, berühmt werden und auch noch Geld dabei verdienen. Der
Schlüssel für den Weg nach oben in die Hitparaden heißt
in der DDR Einstufung. Einstufung, das ist die erste Stufe zum Aufstieg.
Ohne Einstufung wird niemand zum Popstar. Jeder Bezirk der DDR verfügt
über ein sich aus Ortsfunktionären, Musikjournalisten und Musikwissenschaftlern
sowie prominenten Musikern zusammengesetztes Gremium, die Einstufungskommission.
Die Einstufungskommission trennt die Spreu vom Weizen, trennt die ewigen
Amateure von den zukünftigen Profis, entscheidet, welche Popmusik
zum SED-Sozialismus paßt.
Die Kriterien für eine Einstufung sind westlich verwöhnten Popmusik-Konsumenten
zunächst nur schwer begreiflich und nachvollziehbar, zumal dieses
entscheidende kulturpolitische Instrument nicht immer berechenbar auf
sich wandelnde Moden in Politik und Gesellschaft reagiert.
Was muß Tapetenwechsel also tun? Zunächst gut und gründlich
nachdenken, dann mindestens drei Songs schreiben und ein Programm mit
wenigstens zehn Songs auf die Bühne bringen und das immer wieder
üben, üben. Die Einstufungskommission verlangt von jedem Bewerber
ein solides, glattes Kunsthandwerk. Chance hat nur, wer ein in sich geschlossenes,
durchdachtes künstlerisches Konzept vorweisen kann und jederzeit
in der Lage ist, sein Programm exakt zu reproduzieren. Tapetenwechsel
könnte einen Song "Alles ist Scheiße" betiteln, müßte
den nächsten dann aber "Alles wird gut" nennen. Drei Akkorde
pro Song wären durchaus ausreichend, wenn die Musiker ihre Griffe
beherrschen und nicht umgekehrt.
Negativistische oder destruktive Lebenseinstellungen und Musizierstile
haben keinen Platz in der sozialistischen Kultur. Wer behauptet, etwas
sei "Scheiße", muß mit dem nächsten Atemzug
auch Wege heraus aus dieser "Scheiße" weisen. Ein Konzept
gilt nur dann als Konzept, wenn radikale Inhalte vermieden oder doch zumindest
relativiert werden. Ein gutes Konzept ist ein ausgewogenes Konzept, immer
beide Seiten der Medaille zeigend und niemals die Hoffnung verlierend,
also kantenlos und berechenbar zum Wohle der Allgemeinheit wirkend (Also
liberal und nicht sozialistisch - Red.).
Nehmen wir an, Tapetenwechsel nimmt die Hürde der Einstufung. Jetzt
steht der Gruppe der Weg einer staatlich geförderten und behüteten
Popkarriere offen. Jetzt kann Tapetenwechsel öffentlich auftreten,
ein größeres Publikum erreichen und sich mit den Gagen ein
besseres Equipment zulegen. Vielleicht reicht es sogar für ein Studium
an der Musikhochschule oder für die Unterstützung durch den
Rundfunk, beides wiederum unumgängliche Stationen für einen
Plattenvertrag beim Staatslabel Amiga.
Die Praxis der Einstufung ist eine mindestens zweischneidige
Angelegenheit. Auch ostdeutsche Experten gestehen zu, daß sie der
auch in der DDR notwendigen Erneuerung der Kulturlandschaft nicht immer
zuträglich ist. Junge und unverdorbene Musiker und Gruppen, die sich
mit neuen Tönen an die Öffentlichkeit wagen, haben praktisch
keine Chance, die Einstufungsprozedur zu überstehen. Spontane, stark
emotionale und weniger kalkulierte musikalische Ausdrucksformen verkümmern
in den eigenen vier Wänden. Wer es schafft, die Einstufung zu erlangen
und weiter am Ball zu bleiben, hat eine gesicherte Musikerlaufbahn vor
sich. Die DDR ist nicht daran interessiert, ein Heer arbeitsloser und
schlecht ausgebildeter Rockmusiker zu produzieren. Die Kulturpolitik der
DDR betrachtet die Rockmusik als Durchgangsstadium und Versuchsfeld für
ihre Nachwuchsmusiker. Wer sich mit 20 entscheidet, Profi zu werden, soll
später nach abgeschlossener und teurer Ausbildung seinen eigentlichen
Platz im Tanz- und Unterhaltungsorchester oder im Symphonieorchester einnehmen.
Die staatliche Musik-Selektion hat nicht nur politische, sondern auch
ernstzunehmende ökonomische Gründe. Die Musik ist eine Ware,
genauso wie Fleisch oder Bier. Der Konsument hat für sein gutes Geld
Anspruch auf gute Ware. Verdorbenes Fleisch und saures Bier sind Konsumentenbetrug.
Die DDR kann es sich nicht leisten, schlechte Ware zu produzieren. Sie
muß mit ihren knappen Resourcen und Devisen gezielt und wohlüberlegt
wirtschaften. Vinyl und Papier sind nicht gerade reichlich bzw. zu teuer.
Die DDR kann es sich nicht leisten, massenhaft Schallplatten zu produzieren
und zu pressen. Diese Situation erzwingt eine Auswahl; die Ware Musik
muß sich einer kritischen Prüfung unterziehen, um Gutes von
Schlechtem zu trennen.
Den DDR-Punks, die uns schon mit ihrer Musik verblüfften, gelang
es, uns noch ein zweites Mal zu erstaunen. "Sag mal, wann gibt's
denn die zweite DAS IST SCHÖNHEIT Doppel-LP der Hamburger Kunsthochschule?"
oder "Wann geht Saal 4 für die erste LP ins Studio?" fragte
uns der erst 15jährige Rialto Müllmann, der Kopf der Müllstation,
der das Zeug hätte, zum Andreas Dorau der DDR zu werden. Während
die unglaublich freundlichen Punks ein Bier nach dem anderen besorgten,
wurden von ihnen, die noch nie ein SOUNDS, "Spex" oder irgendein
Fanzine in der Hand gehabt haben, weitere bohrende Fragen gestellt. Teilweise
wußten wir die Antworten selbst nicht und die letzten heißen
Neuigkeiten, die wir zu bieten hatten, wurde, wie jede Information aus
dem West-Radio, wißbegierig aufgesogen. Die haben alle soviel Daten
und Hintergründe gesammelt, daß sie mühelos bei einem
InsiderTalk im A.w.g., Risiko oder Ratinger Hof mithalten könnten.
Das Ende unseres Ost-Berlin-Treffs mit Punks aus der ganzen DDR erinnerte
stark an ähnliche Treffen in der BRD in den Jahren '76 - '80. Die
Polizei kam und nahm auf dem Alexanderplatz alle vorübergehend fest.
(Quelle: Sounds 8/82)
Fresse / Information Overload