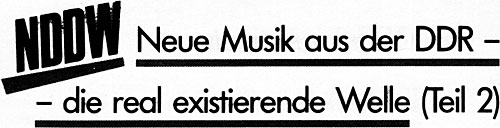
NDDW
Neue Musik aus der DDR - die real existierende Welle (Teil 2)
TAG EINES LEHRLINGS IM DISNEYLAND DER PARANOIA
Palais Schaumburg war der frühere Sitz des Bundeskanzlers. Der Staatsratsvorsitzende residierte früher in einem Palast in Pankow. Doch Ost ist nicht gleich West, Schmidt ist nicht gleich Honecker und Pankow ist nicht gleich Palais Schaumburg.
Von Tim Renner und Thomas Meins
",...dann kotzt die Welt mich an/und hinterher ich sie." "...Jammern macht dümmer/jammern macht's schlimmer/als es in Wirklichkeit ist!"; Pankow, Berlin-Ost 1982. Kräftige Worte und eine schwächliche Lebensweisheit zur SED-Welt und DDR-Wirklichkeit von der kommenden Band aus dem anderen Deutschland. Pankow nennt sich die definitive, 1981 formierte Newcomer-Kombo des DDR-Rock.
 |
|
Brigitte Stefan und Meridian haben eine Silbermedaille
des Ministers für Kultur
|
DDR-Rock - wie langweilig. Die Puhdys, Karat oder Elektra
haben sich mit ihrer Oma-und-Opa-Muzak im Westen nicht gerade mit Ruhm
bekleckert. Längst verblichene Kunst-Rock-Klischees und Verse aus
Kaisers Zeiten können nicht mehr beeindrucken. Das hat man auch im
Osten begriffen. Die schlappen Altvorderen verlieren allmählich den
Fan- und Presseboden unter den Füßen. Höchste Zeit für
eine neue Musikergeneration, wie sie die Gruppen Keks, Brigitte Stephan
& Meridian und vor allem Pankow repräsentieren. Es ist also nicht
nur im Untergrund der DDR etwas in Bewegung gekommen, auch auf der etablierten
Musikszene machen sich Veränderungen bemerkbar. Die Gruppen, die
an die Oberfläche gelangt sind, haben schon Institutionen wie die
Einstufung und die Musikhochschule erfolgreich durchlaufen und Förderung
durch eine Radiostation genossen. Im Gegensatz zu den Untergrund-Musikern
sind die neuen etablierten Bands keine Dilettanten und weniger wagemutig,
haben einiges an jugendlicher Frische verloren, können dafür
aber mit Erfahrung und Ausbildung aufwarten.
Was ist an den "Neutönern" genannten Bands anders als an
den alten DDR-Rockern? Pankow verstehen ihr Konzept immerhin als "bewußten
Gegenpol zum überwiegend lyrischen Rockverständnis anderer Formationen".
Kern des Pankow-Konzepts ist die operettenhaft aufgebaute Alltagsshow
"Paule Panke". "Ein Tag aus dem Leben eines Lehrlings"
ist der Untertitel, und dieser Tag, ein Freitag, wird dem Publikum in
neun Songs vorgeführt, vom Aufstehen des Paule Panke um 5.03 bis
zum Schlafengehen um 24.01 (also genau dann, wenn hierzulande das Nachtleben
erst richtig anfängt). Diese Art von theatralischer Polit-Rock-Show
ist im Westen wahrhaftig nicht der letzte Schrei, in der DDR ist das noch
brandneu.
Die fünf bieder aussehenden Rockmusiker mischen alle mit beim eintönigen
Tagesablauf des Paule Panke, allen voran Sänger Andre Herzberg, der
den Paule auf der Bühne verkörpert. Die optische Umsetzung von
Musik und Text wird durch einige wenige Requisiten unterstützt.
Paule Panke hat Probleme. Die ganz ungewöhnlichen und alltäglichen
Probleme, die man als Jugendlicher, egal ob in Ost oder West, hat, und
ein paar ganz spezielle dazu, die man nur in der DDR haben kann. Paule
steht nicht gerne morgens früh um 5.00 auf, um ab 6.00 in der lärmigen
und hektischen Werkstatt zu schaffen. Recht hat er, das ist ja auch viel
zu früh, kein Wunder, daß die DDR oft so verschlafen ist.
Schon zu Beginn des Programms wird deutlich, daß Pankow die Musik
in erster Linie dazu benutzt, die Texte zu unterstützen. "Wenn
Paule in die Werkstatt kommt/knallt der Lärm an seine Omme"
singt Andre Herzberger, und prompt setzt auch Maschinenlärm vom Band
und eine Stahlpercussion (auch eine totale Neuheit in der DDR) ein. Wie
das nun mal im real-sozialistischen Alltagsleben so ist, folgt am Feierabend,
nach einem harten Arbeitstag, noch eine Versammlung. "Zum Feierabend
gibt's noch ein Bonbon/Mann, es ist Freitag, Kollege Chef/du weißt
doch, da essen wir zeitig!/Da vorne spricht einer von Kampfauftrag/Maschinenauslastung
und Schicht/Paule schlafen die Füße ein/Da ist kein Ende in
Sicht!" Paule mag die Betriebsversammlungen nicht. Pankow ist
da mit ihm einer Meinung (und darf das von offizieller Seite auch ganz
offensichtlich sein), denn sie prangern nicht Paules ablehnende Haltung,
sondern seine Feigheit an. Paule, der seiner Wut über den von der
Partei vorgeplanten Feierabend gerne Luft lassen würde, traut sich
nicht vor den mächtigen Genossen, die da vorne große Reden
schwingen. Die emanzipierte Freundin von Paul, Mathilde ("Der
tägliche Produktionskampf kennt keinen Unterschied zwischen Mann
und Frau"-Propagandaplakat) ist da mutiger, sie erkämpft
den Arbeitskollegen den wohlverdienten Feierabend. Es geht dann musikalisch
getragen und zerfahren weiter, denn als Paule nun endlich um 19.30 (er
war also 13 1/2 Stunden an seinem Arbeitsplatz, und wenn Pankow mit dieser
Arbeitszeit nicht übertrieben hat, dann ist der freie deutsche Gewerkschaftsbund
wohl einer der schlechtesten der Welt. [Der Sozialismus kennt keinen
Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit. Daß seine Durchführung
in der DDR zu wünschen übrig läßt, berechtigt nicht,
seine Institutionen mit kapitalistischer Freizeitideologie zu kritisieren.
- ZK der Red.]) auf dem Heimweg ist, ist er mit sich keineswegs zufrieden.
Von der langen schweren Arbeit physisch und von seinem Versagen auf der
Versammlung psychisch belastet, wird Paule depressiv. "Da draußen
weht naß kalt der Wind/mein Lebensplan ist auch noch blind/wer bin
ich schon, was kann ich denn/ein Kaspar und ein Allesfan/mal will ich
das und mal von dem/und hoch die Wissensfetzen wehn/mal Rock mal Jazz
mal Blasmusik/mal Deutsch mal Sport mal Politik/dann kotzt die Welt mich
an/und hinterher ich sie". War es früher noch gang und gäbe,
daß von DDR-Bands ein Blatt vor den Mund genommen und nur schöne
Gefühle, Kitschiges oder Politisches (aber Linientreues) gesungen
wurde, so schildern heute die "Neutöner" nicht nur die
rosarote, reingeschleckte Welt des Sozialismus, sondern auch Depressionen
und Fehler im System (aber offensichtlich mit der gleichen Pennälerlyrik
["Hoch die Wissensfetzen wehn"] wie früher - Red.).
Zur Freude des Zuhörers mobilisiert Paule jedoch noch einmal seine
Kräfte und geht abends in die Disco. Musikalisch ist das wohl, zumindest
für westliche Ohren, der Höhepunkt des Panke Opus'. Der sonst
störende, weil oft schlechte harte Soli spielende Gitarrist Jürgen
Ehle spielt plötzlich, wenn auch noch etwas zaghaft, eine Disco-Gitarre,
der Bassist, der auch schon vorher kurze funky Passagen in einige Stücke
eingebaut hatte, legt jetzt erst richtig los, und der sehr impulsive Schlagzeuger,
er soll der beste der DDR sein, wird durch eine schüchtern tuckernde
Rhythmusmaschine unterstützt. Ja, so stellt man sich Ost-Disco vor!
Schade nur, daß der Gesang so schlecht ist. "Disco, Disco",
ist das einzige, das die Band in regelmäßigen Abständen
von sich gibt. Das klingt natürlich reichlich blöde (man stelle
sich mal eine Punkband vor, die andauernd nur "Punk, Punk"
brüllt). Plötzlich greift eine Jahrmarktsorgel ein, läßt
Erinnerungen an Godeke Ilse wach werden (ist der etwa in die DDR emigriert?)
und verwandelt den ganzen Song in einen 50er-Jahre-Schlager (auch nicht
schlecht), der im Gegensatz zum Disco-Part wenigstens einen wichtigen
Text hat. "Abends geht Paul in die Disco/- will Mathilde wiederseh'n/Da
sieht er schon von weitem/Wahnsinnsmassenschlangen steh'n (aha, nicht
nur vor der Fleischerei, auch vor der Disco muß man Schlange stehen
- wo bleibt da denn die Lebensqualität?). Viel Düsternis, viel
Kritik, doch am Ende des Tages ist ein breiter Lichtstreifen am deutschen
demokratischen Himmel zu sehen. Der-trotz-alledem-es-geht-voran-Appell
von Pankow heißt: "Komm endlich aus der Knete/denn jammern
macht dümmer/jammern macht's schlimmer/als es in Wirklichkeit ist/Komm
aus'm Arsch!"
 |
|
Mitglied von Gaukler - DDR-Fool-Punks
|
Pankow, das ist nicht nur dieses in sich geschlossene
Rockspektakel, das sind auch Hits wie "Inge Pawelczyk" und "Egal".
Wenn man die Musik betrachtet, sind wohl auch diese beiden Stücke,
obwohl mit Details wie der bereits erwähnten Orgelspielweise, einem
sehr engagiert gespielten Schlagzeug und einem selten auftauchenden Funky-Bass
versehen, nicht sehr interessant. Trotzdem sollte man sich die beiden
Songs, die im September dieses Jahres parallel bei der Amiga und der RCA
(für die BRD) erscheinen werden, ruhig einmal anhören, denn
auch hinter ihnen steht ein für die DDR sehr interessantes, weil
für dortige Verhältnisse revolutionäres Konzept. Wie auch
bei Millionen anderer Songs geht es hier um Liebe, jedoch nicht schön
umschrieben, sondern sehr direkt. "Egal" beschreibt die ersten
Liebeserlebnisse eines Jungen, "Inge Pawelczyk" propagiert eine
oft kritisierte Sexualmoral.
Natürlich kamen die Musiker der Neutöner-Bands nicht aus dem
Nichts. Fast jeder DDR-Musiker muß viele Stationen durchlaufen,
bei einer Menge Bands mitspielen, bevor er bekannt wird, daher ist das
Durchschnittsalter von Pankow, 25-26 Jahre, für dortige Verhältnisse
auch relativ gering. Die Bandmitglieder von Pankow spielten früher
bei Prinzip, 4 PS (zwei eher biederen Bands) und bei den Gauklern, bevor
sie erst zur Gruppe von Veronica Fischer und dann zu der heutigen (Begleit)Band
wurden. Die Gaukler galten als die erste "New Wave" Band der
DDR. Im Programm der 1979 gegründeten Gruppe waren Songs von Madness,
Ian Dury und der "Superboy" von Nina Hagen, für den die
Band dann auch prompt Aufführungsverbot bekam. Auch Keks spielten
von West Bands nach. "My Way" von den Sex Pistols, "Sex
& Drugs & Rock'n'Roll" von Ian Dury, Lieder von Police, sowie
ein Stück von Freddy Quinn in einer Pogo-Version haben sie in ihrem
Programm. Keks, die die bei den DDR-Punks beliebteste Band zu sein scheinen,
bieten auch die härteste Bühnenshow. "Keks spielen hauptsächlich
vor Schülern, kein Wunder, denn die Band ist ja selbst nicht aus
dem Schülerstadium herausgekommen", heißt es in kompetenten
Kreisen in der DDR zu deren Losgeh-Rock Im Gegensatz zu Keks wirkt Pankow
eher schulmeisterlich. Die Musik ist zwar relativ einfach, aber auch sauber
und korrekt arrangiert. Die Funktion der Musik liegt bei Pankow in erster
Linie darin, die Texte, das wichtigste und wohl für die DDR in ihrer
Direktheit fortschrittlichste Element des Programms, zu untermalen. Hier
wird nicht fröhlich bis dümmlich, wie bei Keks, drauflosgerockt,
sondern überlegt Musik gemacht. Auch Brigitte Stefan und Meridian
machen überlegt Musik, doch bei dieser Gruppe scheint das Überlegen
in erster Linie darin zu bestehen, wie man am besten Ideal und die Neonbabies
nachahmt. Der absolute musikalische Höhepunkt der DDR war sicher
die Single "Ich bin da gar nicht pingelig" von Nina Hagen (die
beste Platte, die sie wohl jemals gemacht hat), schön arrangierter
Schlagerpop. Die DDR hätte sie nie aus ihrer Umzäunung herauslassen
sollen, wer weiß, was dann aus ihr geworden wäre... (es geht
übrigens das Gerücht um, daß Alfred Hilsberg bereit wäre,
gegen diese Single sein Zick-Zack-Label einzutauschen).
Pankow hatte mit "Egal" und "Inge Pawelczyk"
Hits, lange bevor diese auf Platte erschienen. Das ist kein kurioser Ausnahmefall,
sondern durchaus so üblich, denn um das Vinyl herzustellen, aus dem
man die Platten preßt, braucht man Rohstoffe, in erster Linie Erdöl,
dieses muß man aber mit harten Devisen bezahlen. Die Amiga, das
für Pop, Rock, Jazz und Schlagermusik zuständige Label der einzigen
Schallplattenfirma der Republik, der VEB Deutsche Schallplatte, bekommt
aber für alle Schallplatten, die sie verkauft, nur den EVP (Einheitlichen
Verkaufs-Preis) von 16,10 der auf dem internationalen Markt fast wertlosen
DDR-Mark. Die Folge ist klar, jede Schallplatte, egal, wie oft sie sich
verkauft, ist für die Amiga ein Verlustgeschäft. Deshalb veröffentlicht
die Amiga ausgesprochen wenig Platten (im Schnitt zwei im Monat) und die
auch nur in viel zu geringen Auflagen. Durch diese fast totale Handlungsunfähigkeit
der Amiga ist das Radio gezwungen, neue Gruppen zu entdecken und Aufnahmen
von bereits bestehenden zu publizieren. Wenn dem DDR-Rundfünk eine
Band interessant erscheint, wird er von dieser erstmal einen Live-Mitschnitt
machen und senden. Aufgrund von Zuschauerresonanz oder starkem Interesse
von Redakteuren wird vom Radio später dann eine Studioaufnahme produziert,
diese muß dann einem Gremium gefallen, um für die Hitparade
vorgeschlagen zu werden. Erst wenn der Song dann in den Charts auf einen
der ganz vorderen Plätze gelangt ist, tritt die Amiga auf die Gruppe
zu. Daran liegt es auch, daß die Gaukler in ihrem zweijährigen
Bestehen nur einen Song (und den auch nur auf einem Sampler) veröffentlichen
konnte. Keks, die sogar schon eine längst vergriffene Single publiziert
haben, müssen auf das Erscheinen ihrer lange geplanten LP wohl mindestens
genauso lange warten wie Pankow auf die Veröffentlichung ihres Panke-Werkes.
Allzu großen finanziellen Erfolg kann eine DDR-Band mit einer Platte
auch nicht erwarten. Jeder Mitspieler bekommt pro aufgenommenes Stück
nur eine Pauschale von 400 Mark, egal wie oft die Platte nun verkauft
wird. Die Gebühren für die Aufführung im Radio stecken,
wie im Westen, natürlich nur die Komponisten ein. Hungern müssen
erfolgreiche DDR-Musiker trotzdem nicht, sie leben von der wesentlich
besser als in der BRD ausgebauten staatlichen Förderung.
Es ist wirklich nicht leicht, in der DDR Rockstar zu werden, es ist aber
auch nicht leicht, sich für neue DDR-Musik zu interessieren. Platten,
so weit es die überhaupt gibt, sind im Nu vergriffen. Was bleibt,
ist DDR-Radio zu hören oder DDR Fernsehen zu gucken (es soll im Fernsehen
bald eine Sendung über neue DDR-Musik starten). Bei DDR-Besuchen
sollte man die Ohren offenhalten, denn von Konzerten hört man meist
nur über Mundpropaganda. Doch um in die DDR zu reisen, sollte man
gute Nerven und eine gewisse Unbefangenheit haben. Die Unbefangenheit
braucht man, um mit allem, was man dort erleben wird, überhaupt etwas
anfangen zu können, denn die DDR und die BRD sind wohl weiter voneinander
entfernt, als Liechtenstein und Angola, und Nerven braucht man halt in
einem Land, dessen treffendste Charakterisierung das von Chris Lunch kreierte
"Disneyland der Paranoia "ist.
(Quelle: Sounds 9/82)
Fresse / Information Overload